Gruppe Quartär- und Paläoklimatologie
Befasst sich mit den Veränderungen der Erde während den Eiszeiten der letzten 2.5 Mio Jahren. In dieser Zeit lag Bern mindestens 15 mal unter einer Eisdecke. Zugleich hat sich der Mensch zum geologischen Faktor entwickelt, der die Umwelt massiv gestaltet. Kies als Rohstoff und Eiszeitdokument, Gletscher, Klimawechsel regional und global sind u.a. unsere Forschungsgebiete.
In der Quartär- und Paläoklimatologie begegnen sich Erdwissenschaften, Biologie, Archäologie, Klimatologie, Ethik, Geotechnik und Entwicklungspolitik.
Forschungsgruppe Quartär- und Paläoklimatologie (In Englisch)
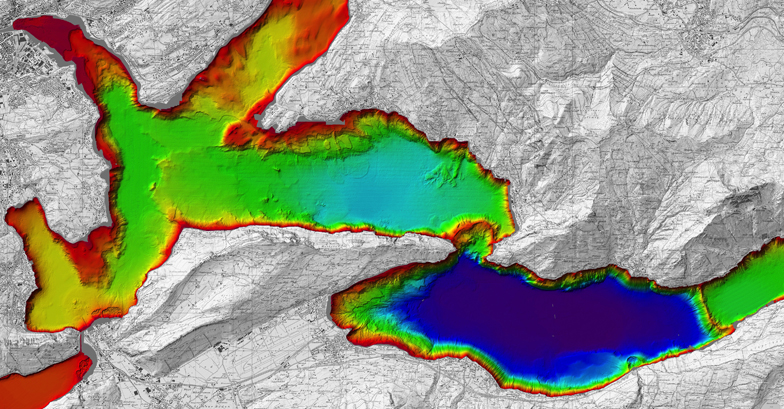
Gruppe Tektonik
Die Kontinente der Erde sind als riesige Platten in Bewegung. Wenn zwei Kontinente aufeinander prallen, werden die Gesteine in der Kontaktzone zusammen gestaucht. Dabei werden die Gesteinsschichten gefaltet und übereinander geschoben. Durch die horizontale Stauchung und das Übereinandertürmen entsteht ein Gebirge. Dieses wird dann sukzessive abgetragen, und Gesteine gelangen an die Oberfläche, welche während der Kollision in Tiefen von über 10–30 km versenkt wurden.
Forschungsgruppe Tektonik (In Englisch)
